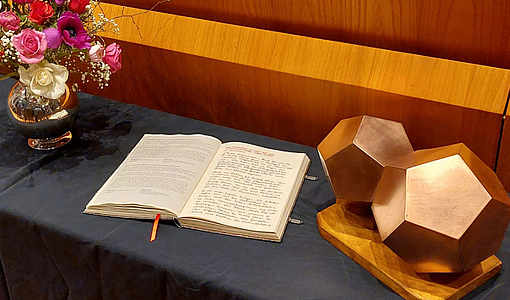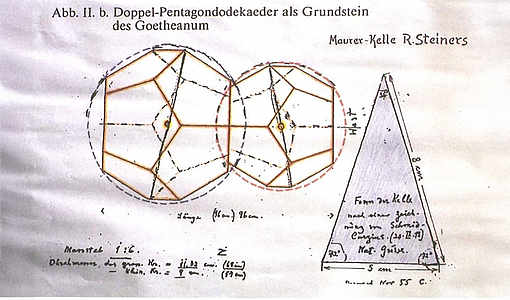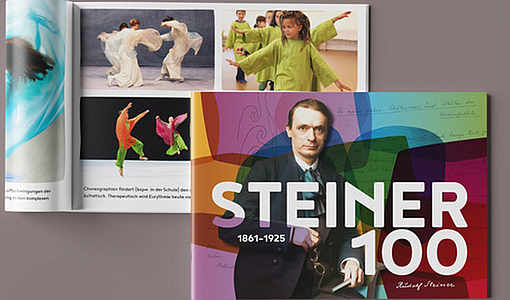Böhme, Steiner und „Der Misston des Bösen“ als Welträtsel
Pilar Bücker über ihre Forschungsarbeit, gefördert von der AGiD

Sebastian Knust: Kannst Du etwas zu Deiner Person sagen? Pilar Bücker: 1995 in Hamburg geboren, besuchte ich 13 Jahre die Rudolf Steiner Schule Harburg, bevor ich bis März diesen Jahres Philosophie im Bachelor an der vormaligen Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues studierte sowie Seminare am Philosophischen Seminar der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte belegte. SK: Warum hast Du dieses Thema gewählt, was interessiert Dich daran? PB: Das Rätsel des Bösen stellt sich als entscheidendes Problem neuzeitlicher Existenzzusammenhänge dar, wenn man den erweiterten Handlungsradius des Menschen durch naturwissenschaftliche Technik bei gleichzeitigem Auseinanderdriften seiner Seelenvermögen in den Blick nimmt, wie es beispielsweise der Existenzphilosoph Günther Anders im 20. Jahrhundert diagnostiziert. In der Auseinandersetzung mit dem Begriff der ›Gelassenheit‹ bei Jakob Böhme (1575–1624) im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit ist mir deutlich geworden, wie zentral die Frage des Bösen in Böhmes Mystik ist und wie umfassend er sie in seinen Schriften darlegt. Die Untersuchung soll vor diesem Hintergrund eine Auslotung des Potenzials der Philosophie Böhmes für den Umgang mit entsprechenden Gegenwartsfragen versuchen. SK: In welchem Zusammenhang steht Dein Thema zur Anthroposophie? PB: Rudolf Steiner geht in seiner Schrift »Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung« der Frage nach, warum und wie Mystik und beginnendes neuzeitlich-naturwissenschaftliches Denken historisch aufeinanderstoßen. Dabei lässt Steiner Böhme als dem Denker, der dieser Situation im Übergang zur Neuzeit existenziell gewahr wird, eine philosophisch bis heute kaum beachtete Gegenwartsbedeutung zukommen. Darüber hinaus ist Steiners eigene Auffassung des Bösen eng mit derjenigen Böhmes verwandt. Böhme begreift das Böse im Weltganzen in erster Linie als ein Gliederungsphänomen, das auftritt, wenn einzelne Glieder eines organischen Ganzen sich im Zuge fortschreitender Differenzierung in Form eines Bruchereignisses verselbstständigen und damit über ihre ursprüngliche Aufgabe hinaus Eigentätigkeit entwickeln. Die diesbezügliche Nähe Steiners zu Böhme, der in seiner Philosophie immer wieder mit dem Motiv des Baumes arbeitet, zeigt sich exemplarisch in Steiners zweitem Mysteriendrama im Bild der Axt, die sich gegen den Baum wenden kann, aus dessen Holz ihr Stiel stammt. Steiner legt es dort in Gestalt des Märchens von dem Guten und dem Bösen der Rolle der »Frau Kühne« in den Mund. SK: Hast Du durch die Beschäftigung mit Deinem Thema schon interessante Ideen oder Perspektiven gefunden? Möchtest Du eine oder mehrere mit uns teilen? PB: Da die Projektzeit erst soeben begonnen ist, lässt sich noch wenig Ergebnishaftes formulieren. Während der Lektüre habe ich allerdings bereits mit großem Interesse feststellen dürfen, wie differenziert Böhme das Verhältnis des menschlichen Selbst zum Bösen während des Erkenntnisaktes beschreibt. Unterschiede und Gemeinsamkeiten dessen, was Böhme dabei als Möglichkeit der doppelten Entgleisung in luziferischen Machtwillen und in die entbundene adamitische Klugheit fasst, und der anthroposophischen Auffassung der »Widersachermächte« in diesem Zusammenhang, wollen nun genauer untersucht werden.