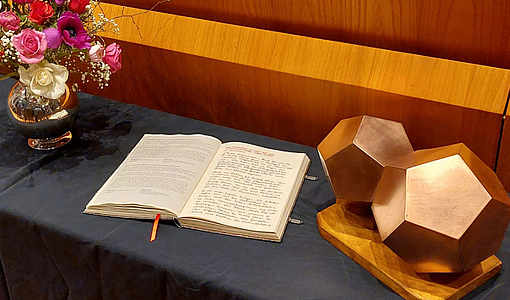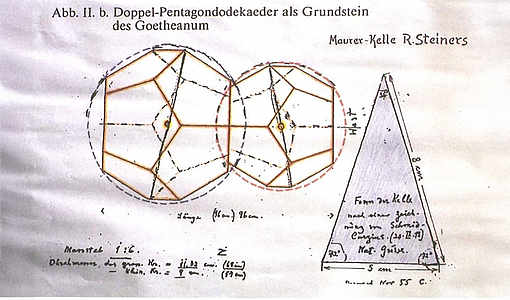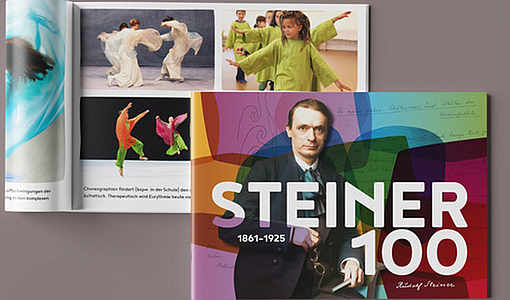Dienen Waffen dem Frieden?
Eine Verzweiflung mit Ausblick.
 Ukraine: Stuhl in zerstörtem Gebäude | Foto: Pixabay
Ukraine: Stuhl in zerstörtem Gebäude | Foto: PixabayDass wir uns Frieden wünschen, ein gedeihliches Miteinander für alle Menschen und natürlich ganz besonders für das Lebensumfeld, in dem wir uns befinden: Wer würde dem nicht zustimmen? Vor nicht allzu langer Zeit war dies für den mitteleuropäischen Durchschnittsmenschen kein Wunsch, sondern eine glückliche, alltägliche Realität – jedenfalls in Bezug auf unmittelbare kriegerische Auseinandersetzungen. Denn die waren doch eher weiter weg, wenn auch die Bilder in den Medien sie uns oft erschreckend nahebrachten. Krieg – eine der vielen Menschheitsplagen, die als Hungersnöte, Naturkatastrophen und Gewalttaten aller Arten die Welt überfluten und mit Flüchtlingsströmen, seuchenartigen Krankheiten und dem Klimawandel zuletzt auch bei uns, im seit Jahrzehnten saturierten Westen, so richtig angekommen waren. Es klingt wie eine Beschreibung aus dem Mittelalter, ist aber Lebensrealität im 21. Jahrhundert. Und jetzt auch noch Krieg. In der Ukraine. In Europa. Hier.
Nach dem Schock des russischen Angriffs von Ende Februar ist Zeit vergangen. Zeit, in der wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, das schreckliche Wort »Krieg« täglich zu denken, auszusprechen, mitzuerleben. Und in seinem Gefolge sind uns all die Schrecknisse und Grausamkeiten, die der Krieg immer birgt, wieder sehr nahegerückt. Wir sind betroffen, bis in die Tiefe der Seele, auch wenn wir nicht direkt von den Bomben getroffen werden.
Krieg bedeutet Ent-Scheidung. Eine Gegnerschaft wird offenbar. Es gibt einen, der angreift, und einen, der angegriffen wird. Der überrannt, geschädigt, vernichtet wird. Oder sich wehrt. Und dann den anderen schädigt und vernichtet. Krieg ist Tod, Leid, Verzweiflung, Schmerz. Dass es irgendwann einmal einen Weg herausgeben wird, geben muss – das ist in dem Augenblick, wo die Bombe einschlägt, nicht von Bedeutung. Krieg ist jetzt.
Ich bin nicht in der Lage, diesen Krieg zu erklären, herzuleiten, verstehbar zu machen. Ich will auch gar nicht in diesen analytischen Kategorien denken, denn wie so oft in unserer komplizierten Zeit ist die Sachlage sehr komplex, und soweit ich beim Lesen von Hintergrundberichten feststelle, findet man für ziemlich jede Ansicht zu diesem Krieg auch eine historische Begründung. Natürlich regt sich mein (mehr oder weniger) kritisches Denkvermögen wenn ich lese, es scheint mir diese oder jene Argumentation schlüssiger. Aber vor allem bin ich oft unangenehm berührt von einer Versachlichung, die das Leben von Menschen, ihre Not und Verzweiflung auf ein politisches Hin oder Her reduziert. Oder abgestoßen von einer sensationsartigen Überemotionalisierung einzelner grausamer Momente, durch die der Blick auf das Eigentliche auch verloren geht.
Eins weiß ich sicher: Ein Angriffskrieg wie dieser ist eine menschliche Grenzüberschreitung. Ein Angriffskrieg ist nicht umsonst völkerrechtswidrig, alles Empfinden wehrt sich gegen erklärende Begründungen einer solchen Tat, egal von welcher Seite. Und er kann auch nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass andere Staaten (westliche!) ebenso völkerrechtswidrige Kriege führen und geführt haben.
Ich bin der Ukraine verbunden, da Freunde von mir dort leben: Andrej Ziltsov, Priester der Christengemeinschaft, und seine Frau Julija. Ich konnte sie zweimal, 2007 und 2010, in Odessa besuchen, an der Pädagogischen Hochschule einen Eurythmiekurs geben sowie mit meiner Freundin und ehemaligen Kollegin jeweils eine kleine Eurythmieaufführung gestalten – unter abenteuerlichen Umständen. Einmal gab es keinen Umkleideraum und wir sind, mit voller Bühnenschminke und die gebügelten Kleider vorsichtig auf den ausgebreiteten Armen tragend, 20 Minuten zu Fuß durch die Straßen bis zum Theater gewandert…
Seitdem dort Krieg ist, telefonieren wir regelmäßig miteinander. Ich habe also die Möglichkeit, von Menschen vor Ort zu hören, wie es im Krieg ist. Es gibt auch eine tägliche meditative Arbeit, in der wir mit vielen anderen Menschen, hier wie dort verbunden sind. Aber es reicht offensichtlich nicht, zu meditieren, denn es ist ja immer noch Krieg, jeden Tag, jetzt.
Wie kann Frieden werden?
#Genau wie in der Coronakrise schlägt bei der Frage nach einer Konfliktlösung gleich wieder die Kraft der Dualität zu und polarisiert: Frieden schaffen mit Waffen? Das ist ein Widerspruch in sich, undenkbar, sagen die einen. Ja, sagt meine Seele, irgendwie stimmt das. – Ohne Waffen geht die Ukraine unter, sagen die anderen. Und nicht nur die Ukraine als Staat, sondern die Menschen, die dort leben. Es wird ihnen genommen, was sie als die Grundlage ihres Lebens verstehen: ihre Freiheit. Das ist für die meisten Menschen in der Ukraine so wenig denkbar, dass sie nun schon seit fünf Monaten kämpfen. Und es sind wirklich die ganz normalen Menschen, die sich diesem Kampf stellen, sagen meine Freunde. Die Verteidigung des Landes wird von Lehrern und Schülern, von Frauen und Männern, auf dem Lande wie in der Stadt, mitgetragen. Sie versorgen die Soldaten mit Lebensmitteln, stellen sich Panzern entgegen und bauen Molotow-Cocktails. Meine Freundin kann unendlich viel erzählen von der Kraft, die diese Menschen antreibt. Aber sie haben nicht genug Waffen, und nicht jene, die sie benötigen. Sie wollen in Frieden leben – und dazu brauchen sie Waffen, um sich gegen den kriegerischen Angriff zur Wehr zu setzen und nicht überrannt und vereinnahmt zu werden. Ja, sagt meine Seele, das müssen sie doch dürfen. – Und was, liebe Seele, ist nun »richtig«?
Und wer entscheidet das? Wir hier in Deutschland, in Europa, entscheiden mit, ob es Waffen für die Ukraine gibt. Wir wollen Frieden und liefern daher Waffen. Oder gerade nicht.
Wie treffen wir diese Entscheidung? Was bewegt uns, so oder so zu entscheiden? Ist es das Mitgefühl mit einem überfallenen Land und seinen Menschen? Ist es die Bereitschaft, zu geben, um was uns diese Menschen bitten, weil sie darin eine unumgängliche Notwendigkeit sehen? Können wir durch kluge Erwägungen den Ukrainern und ihrem Land auf anderen Wegen bessere Hilfe leisten? Nehmen wir vor allem die Fliehenden auf und betrachten die Ukraine selbst als dem Untergang geweiht? Oder geht es mehr um unsere eigenen Ängste, verwickelt zu werden in einen Krieg, der uns dann vielleicht selbst bedroht? Um die Folgen dieses Krieges für unser eigenes Land, denen wir uns kaum entziehen können?
Wir sind jeden Tag konfrontiert mit unendlich vielen Ängsten und Fragen, und diese haben oft damit zu tun, wem und welchen Informationen wir vertrauen wollen oder können. Ist es wirklich das ukrainische Volk, das sich verteidigen will, oder sind es ihre politischen, vielleicht korrupten Eliten? Stimmt die These, dass Friedensverhandlungen erst dann möglich sind, wenn keine der am Krieg beteiligten Parteien mehr glaubt, siegen zu können? Oder gilt eben doch vor allem, dass jede Waffe den schrecklichen Blutzoll erhöht?
Auf der Suche nach Antworten lande ich immer wieder in einem neuen Dilemma. Und so rutsche ich von einem Argument zum nächsten, stelle fest, dass mein Gefühl bereits eine Antwort gegeben hat, die ich aber verteidigen muss, vor mir selbst und vor anderen, und dann wieder in Zweifel gerate, ob ich meinem Empfinden überhaupt vertrauen kann…
Entgleiste Zivilisation
Ich will es also hier aussprechen: Mir scheint es einfach unerträglich, für andere zu entscheiden, wie sie ihr Leben zu führen haben und welche Werte diesem einen Sinn geben sollen. Und mir ist in der Coronakrise deutlich vor Augen geführt worden, dass eine bestimmte Denkungsart mit »Leben« oft nur die biologische Existenz meint, aber für die Frage der individuell erlebten Qualität und der freien Gestaltung wenig Verständnis hat.[1] Aus diesem Erleben und aus meiner eigenen Biografie heraus habe ich ein tiefes Verständnis für den Willen der Menschen in der Ukraine, sich und ihre Lebensweise verteidigen zu wollen. Für den Wunsch, in einem freien Land zu leben. Dass diese Freiheit immer nur relativ ist, wissen sie sehr gut – aber in ihrem zerstrittenen, zum Teil korrupten Land gab es eben doch etwas, was in einem Land unter Putins Führung undenkbar erscheint: Meinungsfreiheit. Wahlen, in denen man etwas entscheiden konnte – unter anderem, einen Komiker zum Präsidenten zu machen. Dass er seinen Job schlechter macht als andere, kann man wahrlich nicht sagen.
Und dem Argument, dass durch eine Ablehnung von Waffenlieferungen ein weiteres Blutvergießen verhindert werden könnte, halte ich entgegen: Wenn dieses Land von der russischen Macht- und Militärmaschinerie überrollt und übernommen wird, dann hört der Krieg doch nicht auf! Er findet dann vielleicht anders statt, in Gefängnissen, mit Deportationen und Repressionen, aber ein »Leben« im Sinne einer selbstbestimmten Existenz wird dann für die meisten Menschen dort nicht möglich sein.
Das ist, wie gesagt, eine Empfindung, keine Analyse. Und eine wesentliche Frage beantwortet sich mir damit nicht, die große Frage, die mich weiterhin umtreibt: Was ist das eigentlich – Krieg? Und wie kann Frieden werden?
Alexander Kluge, der berühmte Filmemacher und ein Mitstreiter des Keine-Waffen-Lagers[2] sagte kurz nach Kriegsbeginn in einem Interview mit dem Schweizer ›Tagesanzeiger‹: »Es macht den Eindruck, dass die Zivilisation in diesen Wochen entgleist – auf allen Seiten.«[3] Das trifft den Kern, scheint mir. Aber es sagt vor allem auch, dass es eine Zivilisation gibt oder gegeben hat, die entgleisen konnte. Dass wir – in Europa, in der Welt – Schritte zu einem anderen Umgang mit uns und unseren Mitmenschen gemacht hatten. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges wollten wir es jedenfalls anders machen und wir haben es auch anders gemacht. Die UNO, die Vereinten Nationen, die allgemeine Anerkennung und Festlegung der Menschenrechte – das sind wesentliche Errungenschaften unserer Zeitepoche.
In einem Interview mit der ›taz‹ legte Florence Gaub[4] – Militärexpertin und stellvertretende Direktorin des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien – dar, welche außerordentliche Tat der Aufbau der europäischen Nachkriegsordnung gewesen ist: »Die europäischen Länder waren noch vor 100 oder 80 Jahren mit die gewalttätigsten der Welt. Heute ist die EU die Oase der Gewaltfreiheit auf der Welt. Man hat nach 1945 entschieden: Wir wollen das nicht mehr. Und hat dann alles unternommen, um Schritt für Schritt die Gewalt aus allen möglichen Bereichen des Lebens zu entfernen. Das ist in anderen Gesellschaften anders. [...] Wir haben keinen Militärdienst, Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr schlagen, Lehrer dürfen Kinder nicht schlagen. Vergewaltigung in der Ehe ist eine Straftat. […] Wir haben eine gewaltfreie Zone geschaffen. Aber wir haben übersehen, dass wir da in diesem Ausmaß die einzigen sind auf der Welt, und dass der Bezug zu Gewalt natürlich in Russland anders ist und in Amerika auch. Die Zustimmungsraten zu Putin gehen jedes Mal hoch, wenn er irgendwo militärisch agiert. Bei uns gewinnt ein Bundeskanzler eine Wahl, wenn er sich gegen einen Krieg ausspricht. [...] Wenn wir nicht verstehen, dass wir die Ausnahme sind und andere einen anderen Bezug haben zu Gewalt, dann machen wir uns verletzlich.«[5]
Die Frage der Anwendung von Gewalt wird in unserem (europäischen) Lebensumfeld also offensichtlich ganz anders bewertet als in vielen anderen Kulturen der Welt – aber sind wir uns dessen bewusst? Und was folgt daraus?
Erdenkrieg und Geisteskampf
In einem Vortrag von 1905[6] entwickelt Rudolf Steiner einen weit ausgreifenden Gedankengang, der vom inneren menschlichen Kampf zwischen Idealismus und Triebnatur, über den Darwinschen Kampf ums Dasein zum Liebesprinzip einer zukünftigen Menschenkultur führt, die durch Geisteswissenschaft zu erringen sei. Allerdings reicht seine Perspektive dabei bis in die kommenden Kulturepochen hinein, sie ist daher für eine aktuelle Krisenbewältigung wohl nicht direkt umsetzbar. Und ein Blick in die Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung zeigt überdeutlich, dass auch dort, wo eine Kultur des Geistes in vielen hundert Büchern und Vorträgen beschrieben wurde, der Idealismus (und auch die innere Schulung) noch nicht aus reicht, um die eigenen Triebe und Leidenschaften in eine Kultur der Liebe zu überführen. Wollen wir also von den Ukrainern fordern, was wir selbst nicht schaffen?
Ziemlich zukunftsdüster klingen dagegen Steiners Vorträge zur Apokalypse des Johannes, die so gern zitiert werden und den künftigen »Krieg aller gegen alle« am Ende dieses Entwicklungszeitraums in der siebten Kulturepoche zum Inhalt haben: »Da sehen wir diese furchtbare Verwüstung der Kultur herankommen und sehen das kleine Häuflein von Menschen, das verstanden hat, das spirituelle Prinzip in sich aufzunehmen und das sich hinwegretten wird gegenüber der allgemeinen Zertrümmerung durch den Egoismus.«[7]
Aber auch ganz andere Blickrichtungen findet man bei Steiner. Während des Ersten Weltkriegs weist er darauf hin, dass die unverbrauchten Ätherleiber der im Felde Gefallenen ihnen nicht nur in einem zukünftigen Leben als Kraftspender zur Verfügung stehen, sondern darüber hinaus wie ein Opfergeschenk zur Entwicklung der Volksgeistigkeit dienen. Und er vergleicht die Notwendigkeit eines Krieges zur Veränderung von Weltzuständen mit einer Krankheit, die ja auch der Entwicklung dienen kann: »In gewisser Beziehung ist dieser Krieg das Karma des Materialismus. Je mehr die Menschenseelen dieses einsehen werden, desto mehr werden sie über das Diskutieren hinauskommen, ob dieser, ob jener den Krieg verschuldet hat, und werden sich sagen: Dieser Krieg ist uns in die Weltgeschichte hineingeschickt worden, dass er ein Mahner sei, dass wir uns zuwenden sollen einem spirituellen Auffassen des ganzen Menschenlebens.«[8]
Auf mich wirken Steiners Ausführungen hier so, als ob er den Menschen Mut machen möchte, sich dem Furchtbaren in sinnvoller Weise zu stellen: Die Frage der spirituellen Vertiefung, die 1905 in einer weiten menschheitlichen Perspektive betrachtet wurde, ist näher gerückt, sie ist dringliche Notwendigkeit im Jetzt geworden: »Und so werden Sie verstehen, wenn ich zu dem vorhin Gesagten zurückkehre: Unsere Zeit hat viele widerstrebende Kräfte gehabt, und wenn wir den Krieg eine Krankheit nennen – wir können das tun –, so ist das eine Krankheit, die herbeigeführt wurde durch etwas, was längst vorher sich abspielte, und er ist da zur Gesundung, damit manches ausgemerzt wird, was zur Schädigung des Lebens der ganzen Kultur nach und nach führen musste. Wenn wir ihn in dem Sinne als Krankheit bezeichnen, wenn wir aber die Krankheit als ein Sich-zur-Wehr-Setzen anschauen, dann verstehen wir diesen Krieg und die schicksaltragenden Ereignisse der Gegenwart, verstehen ihn auch in seinen bedeutsamen Winken und Mahnungen. Dann erleben wir ihn mit allen inneren Kräften unserer Seele, so dass wir recht aufmerksam werden können auf diejenigen, die durch die Pforte des Todes gegangen sind und die hinschauen auf die nächste Zukunft und wirklich das gelernt haben werden, was sie dann in die Seelen, die sie hören wollen, hineininspirieren können: dass spirituelle Vertiefung, die zum Menschenheil und Menschenfortschritt in der nächsten Zukunft notwendig ist, in sie hineinkommen muss.«[9]
Ob der Krieg in der Ukraine sich auch zu einem solchen Weltenbrand wie 1914 und 1939 auswächst, wie es manche befürchten, wissen wir nicht. Das Mittel dagegen führt uns Steiner aber klar vor Augen. Und dieses Mittel, die Entwicklung des Menschen vom Materialismus zu einer wieder geistigeren Weltsicht, ist eingebettet in die ganz große Menschheitsperspektive, führt zu einer immer welttieferen Sicht auf »Krieg« und »Kampf«: Es geht um die Entwicklung von der Weisheit zur Liebe. Und es geht um die falsche Erwartung, dass das Leben in Zukunft bequemer, schöner, ruhiger sein sollte. Denn »Kampf« ist ein Entwicklungsprinzip, auch im Geistigen!
Krieg im Äußeren und im Inneren
Das ist wunderbar ausgeführt in der Bhagavad-Gita, dem zentralen Werk der hinduistischen Spiritualität: Der unerschrockene Prinz und Krieger Arjuna steht mit einem Freund Krishna – der sich später als Inkarnation des Gottes Vishnu erweisen wird – vor einer großen Schlacht. Als Arjuna bemerkt, dass im gegnerischen Heer auch Freunde und Verwandte von ihm kämpfen, erfasst ihn große Angst: »Wenn ich, o Krishna, meine eigenen Leute kampfbereit aufgestellt sehe, beben meine Lippen, mein Mund wird trocken, mein Körper zittert, und meine Haare sträuben sich. Ich vermag nicht mehr zu stehen. Es schwindelt mir. Und ich finde kein Heil darin, meine eigenen Leute in der Schlacht zu töten. Wenngleich sie selbst mich töten würden, o Madhusûdana [= Krishna], möchte ich diese nicht töten, und wäre es für die Herrschaft über die drei Welten; wieviel weniger für die Erde! Ach weh! Wir wissen nicht, was besser für uns wäre: dass wir siegen, oder dass jene uns besiegen. Die Söhne Dhrtarâstras, nach deren Tötung wir nicht mehr leben möchten, stehen uns gegenüber.«
Doch Arjunas Zurückhaltung findet bei Krishna kein Wohlwollen: »Wenn du diese pflichtgemäße Schlacht nicht aufnimmst, gerätst du in Schuld, indem du dein Gesetz und deinen Ruhm verrätst. Entweder wirst du getötet werden und in den Himmel eingehen oder du wirst siegen und die Erde genießen. Darum erhebe dich, o Sohn der Kunti, zum Kampf entschlossen! Nicht durch das Unterlassen der Werke erlangt der Mensch Befreiung von den Werken; nicht durch bloßes Entsagen erlangt er Vollkommenheit. Denn kein Lebewesen kann auch nur einen Augenblick verharren, ohne zu handeln. Vollziehe dein dir zustehendes Werk, denn Handeln ist besser als Nichthandeln.«[10]
Bei Steiner klingt das dann so: »Um was es sich handelt für die Zukunft, das ist nicht, dass es im äußeren Leben bequemer hergehen wird. Die Menschheit wird schon noch größere Unbequemlichkeiten, als diejenigen, die sie sich heute träumen lässt, mit dem Reste der Erdenentwickelung auf sich nehmen müssen. Aber sie wird sie auf sich nehmen, weil sie durch innere Seelenkämpfe – jeder einzelne in seiner Persönlichkeit – gestärkt sein wird. Wenn wir durch den Schleier der Erscheinungen durchsehen, so sehen wir ja nicht auf eine Welt, in der die Götter sagenhaft still, jeder in seinem Bette, schlafen und ein friedsames Leben führen, so wie die Menschen es sich erträumen und was ja doch nichts anderes ist, als eine andere Form des Faulenzerlebens. Nein, so ist es nicht!
Wenn wir den Schleier der Phänomene durchblicken, so sehen wir nicht auf ein göttlich-geistiges Schlafensleben, sondern auf ein göttlich-geistiges, auf ein hierarchisches Arbeitsleben. Und was uns auffällt zunächst, das ist der große Kampf, der hinter der Szene der physisch-sinnlichen Welt stattfindet zwischen der Weisheit und der Liebe. Und der Mensch ist hineingestellt in diesen Kampf.«[11]
Eine Herausforderung, nicht wahr? Da haben wir die Weisheit so sehr verehrt, die Liebe als Kraft so warm empfunden – und jetzt ist das ein Kampf! Damit muss man sich vertieft auseinandersetzen, und so gern ich das hier würde – vor allem, um es selbst besser zu verstehen[12] – geht es doch für die hier aufgeworfene Frage vor allem um das, was im Anschluss gesagt wird. Denn dieser weltdauernde Kampf, der früher im Unbewussten stattfand, muss nun bewusst werden: »Der Mensch muss diesen Kampf in sich selber auskämpfen. Immer stärker und stärker wird die Kraft werden, die auf der Grundlage dieses inneren Seelenkampfes in den menschlichen Naturen sich abzuspielen hat. Nur sträuben sich heute die Menschen noch gegen diese innere Entwickelung. Sie ahnen sie zwar und fürchten sich davor, sie haben aber nicht den Mut zu diesem inneren Kampfe. […] Das ist aber eine Zeiterscheinung, dass die Menschen diesen inneren Kampf nicht bestehen wollen, dass sie ihn noch fliehen, dass sie ihn noch nicht haben wollen, diesen inneren Kampf. Und weil sie ihn nicht innerlich haben wollen, deshalb projiziert er sich heute nach außen. […] Das ist es, was kommen muss: Die Menschen müssen ins Innere hereinnehmen, was sie glauben, heute außen auskämpfen zu müssen. Ein Kriegsschauplatz im Innern der menschlichen Seelen, das wird das Heilmittel sein für das, was heute unter die Menschen so ruinös getreten ist. Nicht früher, als bis dieser innere Kriegsschauplatz in die menschlichen Seelen einzieht, kann dasjenige verglimmen, was äußerlich so furchtbar katastrophal unter die Menschen gekommen ist.«[13]
Den Glauben dennoch nicht verlieren
An dieser Stelle frage ich mich, ob nicht auch das ein Aspekt der gegenwärtigen Krise sein könnte: Die Frage nach dem Geistigen im Menschen – wie sie uns auch die Coronakrise abverlangt hat[14] – haben wir nicht beantwortet. Wir haben diesen Kampf aus uns herausgeworfen, und er kommt uns als Kampf im Außen, als Krieg zwischen Völkern in Europa, wieder entgegen. Wessen Krieg ist es dann, der da gerade wütet? Und wie stehen wir nun ein für das, was wir unterlassen haben? Mit welchen Waffen ist jetzt zu kämpfen?
Und so gelangen meine Gedanken wieder einmal an eines dieser so schwer erträglichen Sowohl-als-Auchs. Natürlich können Waffen keinen Frieden schaffen. Der Friede muss in uns selbst entstehen, in jedem von uns, in dem wir uns innerlich verwandeln und den Kampf in uns führen lernen. Aber das bleibt eben eine innere Tat, die selbst vollzogen werden muss und nicht vom anderen erwartet werden kann. Und sie enthebt uns nicht der Verpflichtung, Menschen in Not zu Hilfe zu kommen. Einer kulturellen Auslöschung zuzusehen, wie sie in der Ukraine stattzufinden droht, und hoffen, dass daraus schon irgendwie mal Frieden wird, weil man nicht Teil dieses Verbrechens werden möchte – und es in Wirklichkeit schon lange ist! – das ist sicher auch keine Friedenstat.
Meine Freunde in Odessa müssen sich diesen Fragen noch konkreter stellen, denn sie berühren unmittelbar ihre Existenz. Was sagt also ein Priester zur Frage der Waffen? In seinem letzten Bericht vom 18. Juni 2022 an die Freunde der Christengemeinschaft schreibt Andrej Ziltsov zu Lage in Odessa: »Der Krieg ist zum Alltag, aber nicht zu einer Gewohnheit geworden. Es gibt Tage, wo immer noch viel Luftalarm (wie gerade jetzt zum Beispiel) zu hören ist, es gibt Tage, da ist es weniger. Es gibt auch immer wieder einzelne Explosionen in der Stadt zu hören. Vorgestern hat unser Präsident Zelenskij die Luftabwehr ›Süd‹ als die beste Luftabwehr des Landes ausgezeichnet, die nicht nur Odessa, sondern auch viele andere ukrainische Gebiete schützt. Es ist also diesen fähigen Kriegs-Männern (und auch neulich gelieferten modernen westlichen Raketen-Systemen!) zu verdanken, dass unsere Stadt verhältnismäßig wenig zerstört ist. Auch hat die See-Militär Einheit ›Süd‹ die neuen Anti-Schiffs-Raketen ›Harpoon‹ bekommen und deswegen müssen die russischen Militär-Schiffe sich viel weiter weg vom Ufer im Meer aufhalten und die Gefahr der Landung ist so gut wie (hoffentlich!) vereitelt. So gehört es zu den immerwährenden seelischen Spannungen des Krieges, dass man sich eigentlich zu der friedfertigen Menschenart rechnet, aber sich zugleich auf die Modernisierung und Lieferung von Waffen freut. Wenn die Ukraine sich jetzt für Waffenfreiheit entscheiden würde, würden wir zivilisatorisch um einige Jahrhunderte zurückgeworfen, was das Verhalten der Angreifer auf den okkupierten ukrainischen Territorien deutlich zeigt. Dennoch! Ich glaube an die zukünftige Menschheit ohne Waffen! Und auch, dass dieser Krieg ›der letzte‹ sein soll! Hoffentlich wird eine Bewegung in der Welt in dieser Richtung entstehen!«[15]
Ja, Andrej, möge uns das gemeinsam gelingen! Die Christengemeinschaften in Odessa und Moskau halten übrigens engen Kontakt und Andrej Ziltsov hat im Mai aus Odessa ein Online-Seminar für werdende Priester in Moskau gehalten. Auch das ist eine Tat.[16]
Ulrike Wendt | freischaffende Eurythmistin, Autorin und Seminarleiterin, mit Schwerpunkt Bildekräfteforschung | Kontakt: info@ulrikewendt.eu
[1] Es ist eine interessante Koinzidenz, dass diese Frage auch in der Diskussion um das Abtreibungsrecht, das in den USA gerade so entscheidend verändert wird, eine Rolle spielt – oder spielen sollte: Wer übernimmt die Verantwortung für das nicht gewollte Kind, das geboren werden muss? Wer sorgt dafür, dass es ein »Leben« hat und nicht nur eine Existenz?
[2] www.emma.de/thema/der-offene-brief-kanzler-scholz-339507
[3] www.tagesanzeiger.ch/in-fast-allen-kriegen-gilt-wer-siegt-stuerzt-ab-264816441140
[4] Florence Gaub ist auch für das Weltwirtschaftsforum tätig und wird von manchen Medien als »NA-TO-Lobbyistin« angefeindet – ihre hier formulierten Gedanken scheinen mir aber jenseits von allen Lagerzugehörigkeiten sehr einleuchtend.
[5] https://taz.de/Florence-Gaub-im-Interview/!5863012/
[6] Rudolf Steiner: ›Unsere Weltlage. Krieg, Frieden und die Wissenschaft des Geistes‹, Vortrag vom 12. Oktober 1905, in ders.: ›Die Welträtsel und die Anthroposophie‹ (GA 54), Dornach 1983, S. 35f.
[7] Vortrag vom 20. Juni 1908 in ders.: ›Die Apokalypse des Johannes‹ (GA 104), Dornach 1985, S. 68.
[8] Vortrag vom 18. Mai 1915 in ders.: ›Das Geheimnis des Todes. Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen Volksgeister‹ (GA 159), Dornach 1980, S. 270.
[9] Vortrag vom 9. Mai 1915 in a.a.O., S. 201.
[10] Die zitierten Stellen stammen aus dem 1., 2. und 3. Gesang der Bhagavad-Gita – www.gita-society.com/gita-15-languages
[11] Rudolf Steiner: ›Die soziale Grundforderung unserer Zeit. In geänderter Zeitlage‹ (GA 186), Dornach 1990, S. 280.
[12] Ich würde dann über die Ausführungen zu Luzifer und Ahriman in ›Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt‹ (GA 158) schreiben, in denen Luzifer als liebekraftender Geist in allen Revolutionen und der erlöste Ahriman als verstehende Gelassenheit beschrieben werden, über die Erlösung der in unseren Leib gelegten Kampfesinstinkte durch das Prinzip der Reinkarnation in Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes »Faust« Bd. II‹ (GA 273) und über vieles Weitere.
[13] A.a.O., Seite 281
[14] Vgl. Ulrike Wendt: ›Immer versehrter und immer heiler – Zukunftsfähigkeit erringen in pandemischen Zeiten‹, in: die Drei 1/2022.
[15] Nur intern weitergegeben, ich darf hier mit Erlaubnis von Andrej Ziltsov daraus zitieren.
[16] Andrej Ziltsov berichtet regelmäßig online im Rahmen von Vortragsveranstaltungen des ›Forum 3‹ in Stuttgart aus Odessa. Wer sich der täglichen meditativen Arbeit anschließen möchte, kann sich gerne an mich wenden: info@ulrikewendt.eu